Ausgabe Nr. 48 · 26. November 2003
Wenn Menschen im Alter hilfsbedürftig werden - was tun? Dieser Frage stehen mehr und mehr Menschen gegenüber, als Betroffene ebenso wie als Angehörige. Antworten möchte ein Informationstag geben, den die Volkhochschule am kommenden Samstag, 29. November, veranstaltet.
Meist entwickelt sich Hilfsbedürftigkeit allmählich, so dass genügend Zeit bleibt, sich darauf einzustellen und Vorkehrungen zu treffen. Häufig aber wird diese Entwicklung übersehen oder gar verdrängt. Hilfsbedürftigkeit kann auch sehr plötzlich - zum Beispiel durch Krankheit oder Unfall - eintreten und ruft dann bei allen Beteiligten ein Gefühl der Rat- und Hilflosigkeit hervor.
Dem möchten die Veranstalter vorbeugen. Ihr Informationstag bietet die Gelegenheit, sich praxisnah mit dem Thema der Hilfsbedürftigkeit älterer Menschen aus allgemeinmedizinischer, psychologischer, organisatorischer und pflegerischer Sicht zu auseinander zu setzen.
Sechs Experten/innen führen mit Kurzvorträgen in das Thema ein. Ein anschließendes Forum gibt Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Referenten/innen zu diskutieren. Weil die Vorträge aufeinander aufbauen und aufeinander verweisen, empfiehlt es sich, nicht nur einzelne Vorträge, sondern die gesamte Veranstaltung am Samstag, 29. November, von 14 bis 18 Uhr im Saal der vhs, Bergheimer Straße 76, zu besuchen. Der Eintritt ist frei.
Die Moderation hat Dr. med. Helmut A. Zappe, der auch den Einführungsvortrag "aus der Sicht des Hausarztes" hält. Dabei geht es um Krankheitsspektrum und gesellschaftliche Situation älterer Menschen, um den Umbau des Gesundheitssystems und die zunehmende Notwendigkeit ambulanter Versorgung.
Psychiatrische Aspekte der Erkrankungen im Alter beleuchtet der Beitrag von Dr. med. Regina Schmitt. Sie stellt Behandlungsmöglichkeiten sowie Anlaufstellen für Beratung und Versorgung vor. Auf psychologische Aspekte im Verhältnis der Pflegebedürftigen zu ihren Angehörigen, auf daraus entstehende Belastungen sowie auf Hilfsangebote geht Dr. Marina Schmitt ein.
Hermann Bühler, Abteilungsleiter Altenarbeit der Stadt Heidelberg, macht mit den städtischen Angeboten zur Betreuung und Pflege älterer Menschen bekannt und informiert über Kurz-, Tages- und Langzeitpflege, ambulante und soziale Hilfsdienste sowie über die Pflegeversicherung. Bei der Abteilung Altenarbeit ist die Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle (IAV) für die Beratung in Versorgungs- und Pflegefragen angesiedelt.
Hospizidee und Einsatzmöglichkeiten der Ambulanten Hospizhilfe stellt Marion Schäfer vom Diakonischen Werk vor. Über das Projekt Case-Management mit gerontopsychiatrisch erkrankten Menschen des Diakonischen Werks berichtet schließlich Dorothee Kuhlen-Mass.

Kahin Sadegh war, betreut von Christine Huber, im OB-Referat tätig, während ...

... Merita Zeka, Eset Selimi, Martin Müller und Patrick Deeth (v.l.) bei den städtischen Werkstätten einen Arbeitstag miterlebten. (Fotos: Neudert)
Selbst aktiv werden und sich bewerben, einen Tag in einem Betrieb sich umschauen und mitarbeiten und den Lohn nicht kassieren, sondern auf ein Aktionskonto des Jugendfonds spenden - das sind die Eckpunkte der Aktion "Werktag", die vergangene Woche in Heidelberg stattfand.
Rund 150 Schülerinnen und Schüler aus Heidelberger Hauptschulen volontierten einen Tag in großen Unternehmen, kleinen Handwerksbetrieben, in Arztpraxen oder Apotheken und auch bei der Stadt Heidelberg. Insgesamt 90 "Arbeitgeber" beteiligten sich und stellten einen Tag lang einen oder mehrere Praktikumsplätze zur Verfügung.
Bei der Stadt Heidelberg traten zwölf Hauptschülerinnen und Hauptschüler ihren Werktag an. Mit dabei war der 15-jährige Kahin Sadegh von der Landhausschule. Er hatte sich bei mehreren Autofirmen für das Praktikum beworben, doch sein Einsatz wurde nicht belohnt. So kam er zur Stadt ins OB-Referat, wo er Urkunden einkaufte sowie Süßigkeiten an Visitenkarten heftete und Mobilés bastelte, die für den Tag der offenen Tür im Rathaus am 14. Dezember gebraucht werden. Eine Besichtigung des Rathauses, die auch ins Arbeitszimmer der Oberbürgermeisterin führte, gab es natürlich auch. "Es hat sehr viel Spaß gemacht", sagt Kahin, aber trotzdem bleibt sein Traumberuf weiter Kfz-Mechaniker.
Patrick Deeth und Martin Müller aus der Geschwister-Scholl-Schule, beide 14 Jahre alt, kamen bei den städtischen Zentralwerkstätten unter. Patrick bei den Schreinern und Martin bei den Schlossern. Das passte ihnen ganz gut, denn diese Berufe wollen sie jeweils lernen. Martin versuchte sich unter anderem an einem Haltegerät für Handys während Patrick Holz strich, Bretter trug und einen Schrank zusammenbaute. Der 15-jährige Eset Selimi und die 14-jährige Merita Zeka aus der gleichen Schule präsentierten sich getupft, denn sie waren in der städtischen Malerwerkstatt untergekommen. Im Keller der Kepler-Realschule strichen sie Wände. Beide berichteten, dass sie sich selbständig um das Praktikum bemüht hätten.
Das gehört zum Konzept des "Werktags". Die Jugendlichen sollen selbst aktiv werden und sich um ihren Praktikumsplatz kümmern. Den Lohn, die Stadt zahlte beispielsweise 50 Euro pro Praktikant, geht auf ein Konto des Jugendfonds und kann zur Finanzierung von Projekten an den Schulen abgerufen werden, die aktiv die Aktion Werktag unterstützten. Einen großen Anteil am Fonds trägt das Land Baden-Württemberg. Auch der Stadtjugendring überwies eine große Summe und die Einnahmen des Sommerspektakels in der Weststadt und private Spenden flossen mit ein.
Organisatorin Stefanie Ferdinand vom Jugendfonds ist zufrieden mit dem ersten Werktag in Heidelberg. Sie bedankt sich bei den Betrieben und Einrichtungen, die die Aktion mit Praktikumsplätzen unterstützten. Dazu gehören unter anderem Henkel Teroson, das Marriott-Hotel,
Breer Gebäudereinigung, Citydruck, Heidelberger Zement, die Bäckerei Mahlzahn, ifa, das Öko-Kaufhaus "fair und quer", Apotheken, Drogerien, Pflegeheime und die Heidelberger Dienste. Träger des Jugendfonds sind die Freiwilligenbörse, das Evangelische Kinder- und Jugendwerk, das Katholische Jugendbüro und die Jugendagentur Heidelberg. (neu)

Alfred Weber

1923 übernimmt Alfred Weber die Leitung des nationalökonomischen Instituts, das er in Institut für Sozial- und Staatswissenschaften umbenennt. Das Gruppenfoto entstand nach dem Umzug 1927 in das Palais Weimar (heute Völkerkundemuseum) anlässlich der Einweihung. (Foto: Universitätsarchiv)
Das Universitätsmuseum zeigt zurzeit die von Weber-Biograph Eberhard Demm zusammengestellte Ausstellung "Geist und Politik - der Heidelberger Gelehrtenpolitiker Alfred Weber (1868-1958)". Weber war Zeit seines Lebens nicht nur Wissenschaftler, sondern ebenso ein engagierter Kämpfer für Demokratie.
Eröffnet wurde die Ausstellung in der vergangenen Woche von Prorektor Prof. Dr. Angelos Chaniotis. "Geist und Politik waren die beiden Pole, um die Alfred Webers Leben kreiste", so Prof. Dr. Eberhard Demm, der in die Ausstellung einführte. Zunächst lehrte Weber in Berlin und Prag Nationalökonomie. 1907 kam er nach Heidelberg, wo er bald über die Grenzen seines Fachgebiets hinausgriff und über Geschichtsphilosophie, Kultur- und Staatssoziologie arbeitete.
Die Politik ließ ihn niemals los. Im Kaiserreich vor allem sozialpolitisch aktiv, kämpfte er seit 1918 gegen Kommunisten und Nationalsozialisten für den Erhalt der Weimarer Demokratie. Als 1933 die Hakenkreuzfahne vor seinem Heidelberger Institut hochgezogen wurde, sorgte er in einem "Akt beispielhafter Zivilcourage" (Demm) für ihre Entfernung.
Im März 1933 ließ er sich vorzeitig emeritieren und schloss sich später einer Widerstandsgruppe an. Ab 1945 engagierte er sich für den demokratischen Neubeginn, später trat er für die Wiedervereinigung und Neutralisierung Deutschlands ein. "Weber war einer der wenigen Hochschullehrer, die sich offen zur Sozialdemokratie und zur Gewerkschaftsbewegung bekannten", berichtete Prof. Dr. Heinz Markmann, ein Zeitzeuge, der in den 50-er Jahren ein enger Mitarbeiter Webers und Sprecher des SDS in Heidelberg war.
"Alfred Weber litt darunter, dass Anfang der 50-er Jahre die von der Spruchkammer mit befristetem Lehrverbot belegten Hochschullehrer allmählich wieder an die Universität zurückkehrten", so Markmann. Er sei von der Frage umgetrieben worden, was zu tun sei, um weitere Rückfälle in die Diktatur zu verhindern.
Bei der Eröffnung der Ausstellung wurde auch der jüngst erschienene Band 10 der von Richard Bräu, Eberhard Demm, Hans G. Nutzinger und Walter Witzenmann herausgegebenen Alfred Weber-Gesamtausgabe vorgestellt. Er enthält eine Auswahl aus Webers Briefwechsel - eine, wie Markmann hervorhob, durchaus fesselnde Lektüre.
Die Ausstellung, zu der im Verlag Regionalkultur ein kleiner Katalog erschienen ist, ist bis zum 31. März 2004 im Foyer des Universitätsmuseums, Grabengasse 1, dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr zu sehen. (rie)

Der symbolische Schutzwall für das Völkerrecht wartet jetzt in der Stadtbücherei auf weitere Unterzeichner. (Foto: Rothe)
Monatelang zog der hölzerne "Schutzwall für das Völkerrecht" auf dem Bismarckplatz die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich und eine breite Zustimmung der Passanten nach sich. Obwohl der symbolische Schutzwall seit einiger Zeit nicht mehr auf dem Bismarckplatz steht, ist er nicht weg; er befindet sich jetzt in der Stadtbücherei.
Dort im Bibliotheks-Foyer an der Poststraße - und somit im "witterungsgeschützten öffentlichen Raum" - soll der Schutzwall weiter wachsen. Bis er, das ist der Wunsch seiner Initiatoren (der Schülersprecher/innen der Heidelberger Gymnasien), einmal als sicht- und greifbares Zeichen des Protestes gegen die Missachtung des in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Gewaltverbotes auf dem UNO-Gelände in New York aufgestellt werden kann.
In New York hat man die Heidelberger Aktion bereits zur Kenntnis genommen. Nachdem Mitte März der Bau des "Schutzwalls" auf dem Bismarckplatz begonnen hatte, erreichte die Verantwortlichen der Aktion per E-Mail folgende Nachricht: "...Botschafter Dr. Pleuger und das Team der Ständigen Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York danken Ihnen für Ihren Einsatz für das Völkerecht...". Absender war Dr. Dirk Rotenberg, Sprecher der Ständigen Vertretung.
Schon vorher hatte der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Prof. Dr. Thomas Bruha (Universität Hamburg), die Heidelberger Initiative gelobt: "Ein derartiges beherztes Engagement für die Geltung des Rechts und die Zuständigkeit der Vereinten Nationen in den internationalen Beziehungen ist beispielhaft und lässt für die Zukunft hoffen. Bitte weiter so!"
Vor kurzem wurde die Aktion Völkerrecht mit dem Friedenspreis der Stiftung Heidelberger Friedenskreuz ausgezeichnet. Und auch in anderen deutschen Städten findet sie Beachtung: Im Oktober steuerten in Essen rund 500 Menschen, darunter der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Michael Vesper, ihre persönlichen Steine zum Schutzwall bei.
Noch einen Wunsch haben die Initiatoren der Aktion: Dass Schüler/innen überall in der Welt die Idee aufgreifen, an ihren Schulen jeweils 250 Unterschriften sammeln und so Meter für Meter an den symbolischen Schutzwall anfügen. Auf diesem Wege könnten Heidelberger Schulen Kontakte rund um den Globus knüpfen und die Vertreter/innen der beteiligten Schulen beim Aufbau des Schutzwalles bei den Vereinten Nationen persönlich treffen. (br.)

Toter Sappenposten nannte Otto Dix diese Darstellung.
Ein reines Vergnügen ist es sicher nicht, die Ausstellungen der Radierungen von Otto Dix "Der Krieg" in der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte anzuschauen. Die Bilder zeigen Szenen aus dem Ersten Weltkrieg: grausam, brutal, realistisch.
Otto Dix (1891-1969), Arbeitersohn aus dem thüringischen Gera, war einer der bedeutendsten deutschen Künstler des vorigen Jahrhunderts. Den Krieg hat er von 1914 bis 1918 über vier Jahre lang miterlebt - überwiegend im Stellungskrieg an der damaligen Westfront. Das Vegetieren in den Schützengräben, beschrieb er treffend mit wenigen Worten: "Hunger, Läuse, Schlamm, diese wahnsinnigen Geräusche..."
Seine Eindrücke und Erinnerungen an die Schlachtfelder in der Champagne, an der Somme, im Artois und in Flandern hat Otto Dix in seinem 1924 entstandenen Zyklus von 50 Radierungen "Der Krieg" festgehalten. Diese "veristischen" Graphiken, die ganz gewiss nicht dem damals von den nationalistischen Kreisen propagierten soldatischen Heldentum entsprachen, gehören zu den eindringlichsten Darstellungen des Tötens und Sterbens im ersten Weltkrieg.
Die Bilder des Zyklus waren in fünf Mappen mit jeweils zehn Graphiken in 70 Exemplaren aufgelegt worden. Die Radierungen, die jetzt im Ebert-Haus in der Pfaffengasse zu sehen sind, stammen aus dem Besitz der Galerie der Stadt Stuttgart. Mit der Präsentation dieser Sonderausstellung griff die Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte eine Anregung des Heidelberger Kunsthistorikers Prof. Dr. Dietrich Schubert auf.
Professor Schubert, der sich eingehend mit dem Werk von Otto Dix befasst, hat die Ausstellung mit organisiert und dazu ein Buch zu Dix' Kriegs-Zyklus herausgegeben. Es enthält Abbildungen aller 50 ausgestellten Radierungen sowie weiterer Arbeiten von Dix mit ausführlichen Erklärungen und Kommentaren des Kunsthistorikers. Professor Schubert führte deshalb auch anlässlich der Ausstellungseröffnung am vergangen Sonntag, 23. November, in die Ausstellung ein.
Die Ebert-Gedenkstätte, Pfaffengasse 18, zeigt die Radierungen "Der Krieg" von Otto Dix bis einschließlich Sonntag 18. Januar 2004. Der Eintritt ist frei. (br.)
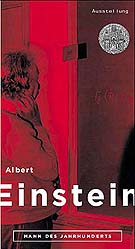
"Im letzten Grunde ist jeder ein Mensch, gleichgültig ob Amerikaner, Deutscher, Jude oder Nichtjude." Diese Worte aus der Feder Albert Einsteins sind heute so aktuell wie damals. Das Leben des großen Physikers, Humanisten und politisch engagierten Juden, der wie kein anderer Wissenschaftler das vergangene Jahrhundert geprägt hat, steht derzeit im Mittelpunkt der Ausstellung "Albert Einstein - Mann des Jahrhunderts" im Kirchhoff-Institut für Physik.
Konzipiert wurde die Ausstellung von der Hebräischen Universität Jerusalem (deren Mitbegründer Albert Einstein im Jahr 1925 war) in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg - die beiden Hochschulen verbindet eine inzwischen bereits 20 Jahre andauernde Partnerschaft. Nachdem die Ausstellung schon in New York, Berlin und München erfolgreich war, ist sie nun - anlässlich dieses Jubiläums - bis zum 6. Februar auch in Heidelberg zu sehen.
Die Ausstellung zeigt eine Auswahl an reproduzierten Dokumenten aus dem Albert-Einstein-Archiv der Hebräischen Universität Jerusalem, darunter Manuskripte, Briefe, Fotografien und ein kurzer Film. Im Vordergrund steht jedoch weniger der Wissenschaftler als vielmehr der Mensch Albert Einstein.
Vermittelt werden sowohl Einsteins wissenschaftliches Genie und sein großer politisch-gesellschaftlicher Scharfblick als auch sein unvergleichlicher Humor und sein für alle Altersgruppen gleichermaßen faszinierendes Wesen.
Einsteins Theorien überspannten die fundamentalsten Fragen der Natur, vom Universum bis zu den Elementarteilchen, wobei er die überkommenen Vorstellungen von Zeit und Raum, Energie und Materie grundlegend veränderte. Trotzdem standen Menschlichkeit und Toleranz stets an oberster Stelle für den Physiker, der völlig zu Unrecht als der "Vater der Atombombe" gilt: Tatsächlich war Einstein als "Sicherheitsrisiko" von diesem Forschungsprojekt ausgeschlossen worden und er war mehr als entsetzt angesichts der verheerenden Wirkung der Bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki.
Kirchhoff-Institut für Physik, Im Neuenheimer Feld 227, Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, bis 6. Februar. Informationen: Telefon 54-8228 oder unter www.uni-heidelberg.de/ausstellungen/einstein.

Bildübergabe im Senatssaal: Oberbürgermeisterin Beate Weber (2. v. r.), Rektor Prof. Dr. Peter Hommelhoff (r.), Prorektorin Prof. Dr. Silke Leopold und Dr. Frieder Hepp, Direktor des Kurpfälzischen Museums. (Foto: Rothe)
Das Kurpfälzische Museum der Stadt Heidelberg hat der Universität für den Senatssaal ein Bild des Heidelberger Malers Guido Schmitt als Leihgabe zur Verfügung gestellt, das jetzt feierlich enthüllt wurde.
Das großformatige Ölgemälde zeigt als Personifikation der Universität, eine antik gewandete Priesterin, die Alma Mater, in Lebensgröße vor einem reich ausgestatten Thron, der einen Lehrstuhl symbolisiert. Die beiden Löwen auf den Armlehnen sowie die Initialen "RC" in Verbindung mit den Jahreszahlen 1368 und 1886 auf der gotisierend ausgeschmückten Rückenlehne stellen den Bezug zur Heidelberger Universität her.
Im Hintergrund steht die Büste des "Rupertus", Kurfürst Ruprecht I. (1309-1390), der die Universität 1386 gegründet hat, während die Bildunterschrift "A Carolo Friderico restituta" auf die Wiederherstellung der Heidelberger Universität durch Großherzog Carl Friedrich (1728-1811) vor zweihundert Jahren verweist. Seither heißt sie Ruperto Carola.

(Foto: Rothe)
Copyright © Stadt Heidelberg 1999, All Rights Reserved
Stand: 25. November 2003